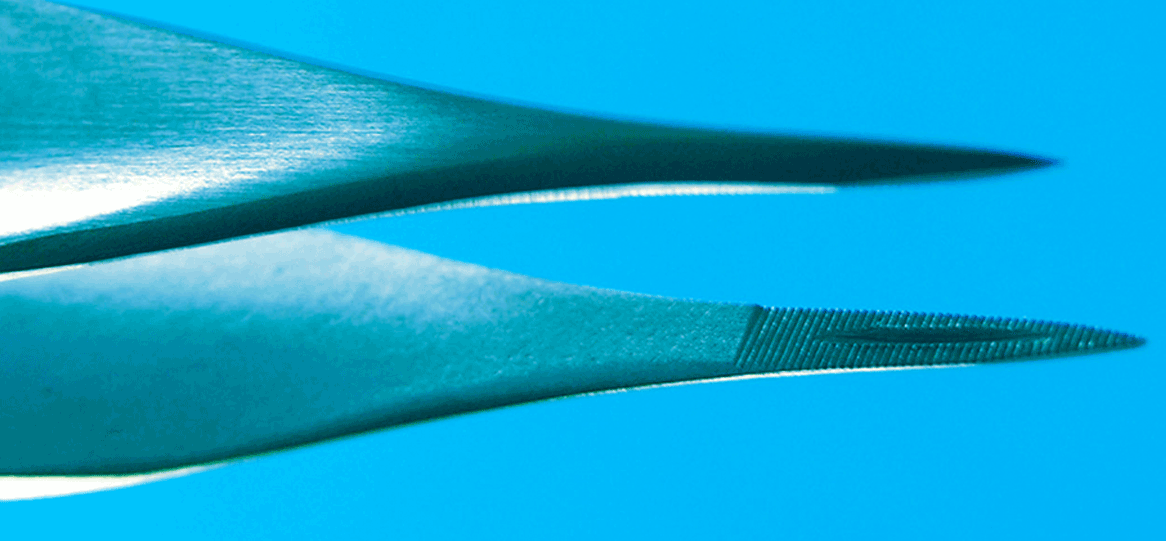Dass die interprofessionelle Zusammenarbeit (kurz IPZ) verstärkt werden muss, ist heute praktisch unbestritten. Funktionierende interprofessionelle Teams werden als wichtiger Teil der Zukunft des Gesundheitssystems angesehen. Es gibt da jedoch ein grosses Aber. Denn: Der allgemeinen Bejahung zum Trotz hinkt die praktische Umsetzung deutlich hinterher. Warum ist das so und welche Faktoren fördern oder hindern IPZ? Dieser Frage hat college M im Auftrag der SAMW eine Studie gewidmet. Diese steht nun zum Download zur Verfügung – mit zwei zentralen Erkenntnissen.
Aber der Reihe nach: Das Gesundheitssystem und seine Organisation sind heute grundsätzlich professionell orientiert und aufgebaut. Dieser Aufbau bringt den entschiedenen Vorteil, dass sich die involvierten Professionellen in diesem System von der Annahme leiten lassen dürfen, dass alle aufgrund ihres Trainings wissen, was zu tun ist. Es bedarf also beispielsweise keiner besonderen Abstimmungsbemühungen, wenn ein Patient eine Blinddarmoperation vor sich hat. Dieser, wie wir ihn nennen, «Normalfall», entlastet ungemein im Spitalalltag und stellt erst die tagtägliche Handlungsfähigkeit dieses komplexen Systems sicher. Eine Abweichung vom «Normalfall» benötigt demnach – zu Recht – gute Gründe, um sich behaupten zu können. Schliesslich steht einiges auf dem Spiel!
Eine Abweichung vom «Normalfall» braucht gute Gründe.
Damit stellt sich die Frage, wie und unter welchen Voraussetzungen IPZ als Abweichung von diesem Normalfall bestehen kann. Unsere Studie rückt zwei zentrale Aspekte in den Fokus.
Nämlich: Es braucht IPZ-Formen, die dem jeweiligen Kontext angepasst sind. Es gibt also nicht «one best way» für IPZ. Vielmehr sind alle Professionellen aufgefordert, sich einzubringen, um für den eigenen individuellen Kontext kreative, neue Formen für IPZ zu definieren. Dabei scheinen aufgrund der Studie Krankheiten umso «interessanter» für IPZ zu sein, je komplexer und psychosozialer sie sind.
Es gibt also nicht «one best way» für IPZ.
Das führt uns zum zweiten zentralen und vielleicht auch irritierenden Aspekt: IPZ muss nämlich zwingend sowohl den involvierten beteiligten Fachpersonen – allen voran dem ärztlichen Führungspersonal – als auch den Patienten einen Nutzen bringen. Alleine der Nutzen «für den Patienten» reicht nicht aus, um genügend Energie für IPZ im System freizusetzen. Es braucht auch die Erfahrung der Professionellen, dass diese Kooperation für ihre Arbeit nützlich ist. Sonst droht der «Normalfall» den Alltag rasch wieder zu dominieren und der Ruf nach IPZ schallt ins Leere.
Und das noch zum Schluss: Im Rahmen der Studie konnten wir vier Fallbeispiele untersuchen. Dabei hat uns die Kreativität und das Engagement, mit der Lösungen gefunden wurden, die den «Normalfall» Professionalität nachhaltig überwinden lassen, und die Sorgsamkeit, mit der eine Kultur der IPZ gepflegt wird, hoch beeindruckt.
Wollen auch Sie sich in Ihrer Organisation verstärkt mit IPZ auseinandersetzen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.