Die Medien berichten fortlaufend, dass die Spitäler 2024 besser abgeschnitten haben als das (katastrophale) Jahr zuvor. Ist das schon Grund zur Beruhigung? Oder gibt es tieferliegende Probleme, die weiter beunruhigen sollten? Tatsächlich zeigen sich Vergütungssystem, Management wie Governance-Strukturen weiterhin als «problematisch». Wichtig wäre, in den Blick zu nehmen, wie die Komplexität des Systems gestiegen ist.
Das Problem der Tarife
Nicht nur für die Trump-USA sind Tarife Thema. Auch die flächendeckenden Ergebnisse der Spitäler weisen auf Handlungsbedarf hin. Der bereitet wenig Freude, schliesslich drohen Kostensteigerungen. Entsprechend wäre man froh, würden sich das Thema irgendwie erledigen …
Eigentlich hätten mit der Einführung des DRG-Systems drei Fliegen auf einen Schlag erledigt werden sollen. 1) sollten Spitäler Investitionen aus ihren Erträgen finanzieren. 2) sollten sie damit zu betriebswirtschaftlich verantwortlichen Einheiten werden. 3) sollte der via DRGs mögliche (Effizienz-)Vergleich einen Abbau der als zu hoch eingeschätzten Bettenzahl bewirken. Alle drei Annahmen gingen in die Leere. Das vorgestellte System entpuppt sich als Fiktion. Weder sind die Investitionskosten finanzierbar, noch wurde die Selbständigkeit wie vorgestellt erreicht. Und die Verringerung der Bettenzahl blieb marginal.
Eine neue Grundkonstellation
Die DRG-Einführung und der darüber (gewollt) entstehende Effizienz-Druck führten allerdings zu einer veränderten Grundkonstellation in den Spitälern. Mit dem DRG-System wurden in neuer Weise wirtschaftliche Kalküle in ein Verhältnis zu medizinischen Leistungen gesetzt. Die Auseinandersetzungen darüber haben die stationäre Versorgung in den letzten Jahren massiv geprägt.
Speziell die Ärzteschaft erlebte ein Aufkommen des Controllings in den Spitälern – mit den bekannt «gemischten Gefühlen». Die ins Spiel kommenden Kosten-Ertrags-Kalküle ermöglichten Quantifizierungen (s. «Business Plan») und Messungen (s. «Key Performance Indicators») und erzeugten Entscheidbarkeiten in zuvor praktisch „unentscheidbaren“ Situationen (z.B. die Diskussion der Öffnung oder Schliessung einer IMC bei hoch widersprüchlichen medizinischen Einschätzungen der verschiedenen medizinischer Akteure).
Die „Eleganz“ des Controllings besteht darin, schwierige und detailreiche Situationen durch Quantifizierung (und damit Abstrahierung) in Entscheidbarkeit zu überführen. Um es mit dem Soziologen Werner Vogd zu formulieren: Entscheidungen können so getroffen werden, ohne „allzu viel von den Nöten der die tägliche Arbeit verrichtenden Ärzte und Pfleger“ wissen zu müssen.
Die «Kunst» des Spitalmanagements
Wenn komplexitätsreduzierende, wirtschaftliche Kalküle auf die Details klinisch-medizinischer Situationen treffen, ist das immer brisant. Und eben diese Brisanz zeichnete viele Auseinandersetzung der letzten Jahre: die Versuche des Managements Reformen und Optimierungen auf den Weg zu bringen, die in unauflösbarer Spannung zu den konkreten Problemen der klinischen Praxis stehen. Diese Spannung zu moderieren, also einen bewussten Umgang damit zu pflegen (und nicht nur die eine Seite der Spannung zu befördern) war, ist und wird noch mehr die „Kunst“ des Spitalmanagements. Ein Misslingen dieser Moderation drückte sich z.B. in der Aufkündigung des Vertrauens der Inselspital-ChefärztInnen zum vormaligen CEO vor rund einem Jahr aus.: „Die Spitalführung ist zu weit entfernt“, hiess es. Das war das Ende der „Moderation“.
War über Jahre der Tenor (in Spital- und Verwaltungsräten und der teilweise der Öffentlichkeit) sinngemäss, dass Spitäler so «geführt» werden müssen, so dass sie (endlich) die Tugenden privatwirtschaftlich geführter Unternehmen entwickeln mögen, zeigt sich nun, dass dabei ein wichtiges Merkmal unterbelichtet blieb: Spitäler sind hybride Organisationen, die nicht nur auf Effizienz trimmbar sind. Das ist nur die eine Seite der Optimierungsmedaille, die andere heisst Innovation & Qualität. Diese Spannung zwischen Effizienz und Innovation zu balancieren, wird in den nächsten Jahren ein markantes Auseinandersetzungsfeld bilden.
Teil II wird Als-ob-Governance Strukturen und das Problem der Komplexität zum Thema haben.

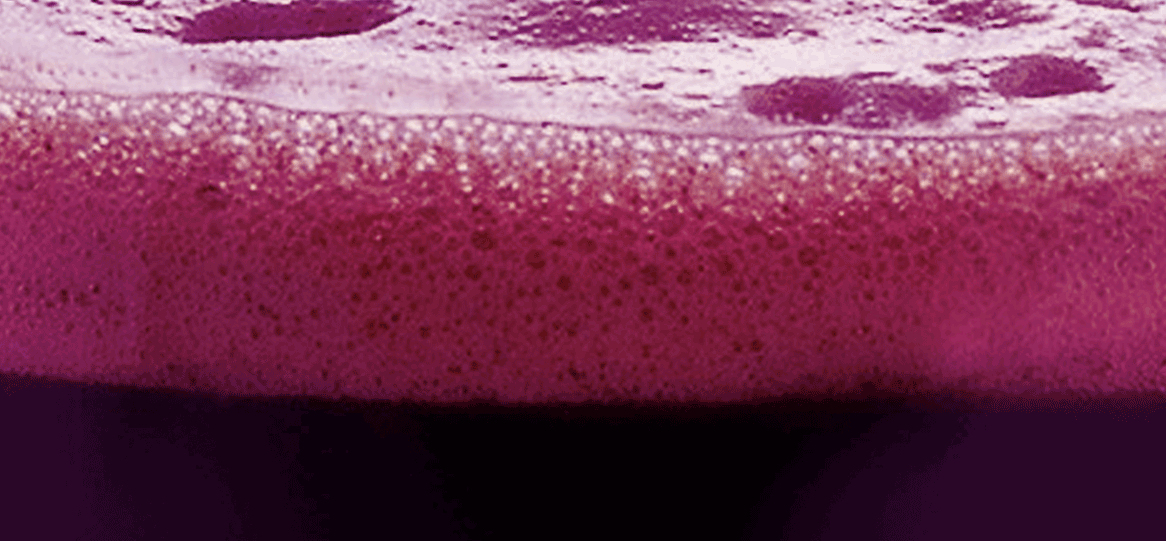
Kommentar